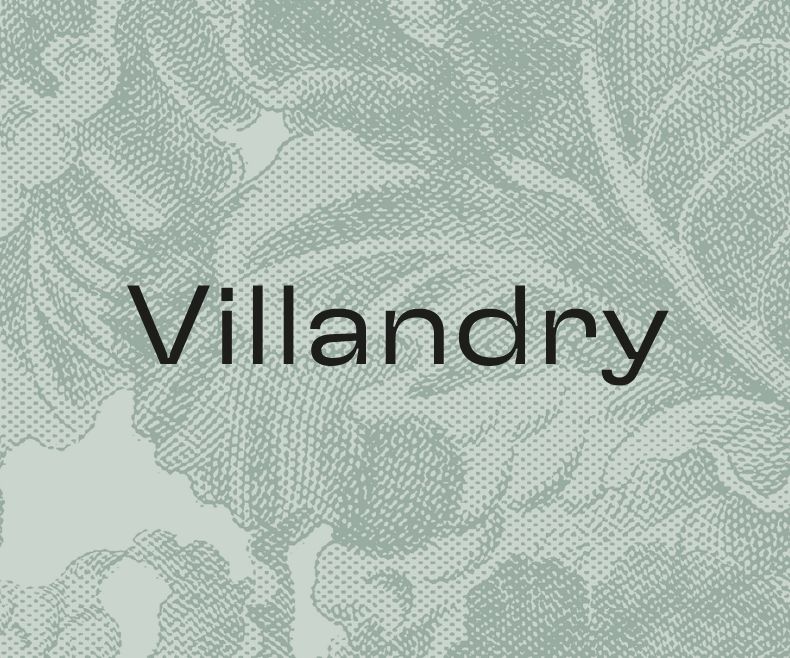Für diese These werde ich ungläubiges Kopfschütteln ernten. Monokel, was soll das? Heute trägt man entweder Brille. Selbst die sogenannten Kassengestelle sehen nicht mehr „billig“ aus. Als Kind wurde ich wegen diesem, ich sage es mal euphemistisch, kostengünstigen Nasenfahrrad in der Schule noch gehänselt. Oder man setzt sich Multifokallinsen auf den Augapfel. Auch eine modische neue Farbe für die Iris kann man sich gerne ohne Probleme antun. Der aktuelle letzte Partyschrei. Aber ein Monokel? Und das komische Ding soll auch noch eine gute Kinderstube zum Ausdruck bringen? Ich kann das nicht beweisen, aber wer weiß schon, was künftig kommt?

Der Monokelträger
Aber 1920 waren die Zeiten noch nicht goldig. Armut breitete sich aus und die Inflation nahm Fahrt auf. In der Arbeiterschaft brodelte es. Und es zeichneten sich schon in bestimmten Kreisen des Bürgertums und der Künstlerschaft eine beginnende Leichtigkeit des Seins ab, ein Hang zum Vergnügen und zur Dekadenz, eine neue Zeit, die mehr Raum für Individualität zuließ. Der Schurbart eroberte sich das Männergesicht in allen Schichten.
Darum brauchten die sich für besser oder anders haltenden Menschen ein Alleinstellungsmerkmal. Und das waren das Monokel und sein obskurer Träger. „Der eine hält ihn für einen Fatzke und wird fuchsteufelswild, wenn er nur einen Menschen sieht, der ‚sich ein Schaufenster eingesetzt hat‘, wie der Volksmund so nett sagt. Die anderen betrachten ihn als gewollte Ausnahmeerscheinung, als eine Art Kuriosität, und gehen lächelnd zur Tagesordnung über“, hieß es in der Zeitung.
Ganz so tolerant war das Blatt aber dann doch nicht, besonders, wenn es sogenannte Dandys betrachtete. „Gewiss, der Portokassenjüngling, der sich zum Sonntag zur Verschönerung des Festgewandes eine ‚Scherbe‘ einklemmt, ist eine Erscheinung, die Berechtigung gibt, sich darüber zu mokieren. Aber schließlich geht das allen an und für sich guten Dingen so, daß Missbrauch mit ihnen getrieben wird.“

Ja, so gestelzt berichtete man in diesem Blatt. Man müsse sich doch von der proletenhaften, fäkaliendurchdrungenen und sexualisierten Volkssprache der unteren Schichten unterscheiden. Aber ein paar Gläser Champagner oder mehrere Cocktails haben schon bei manchen sogenannten Gebildeten und Hochwohlgeborenen den Schleier der Vornehmheit und Eitelkeit vom Gesicht gezogen. Und die menschliche Gewöhnlichkeit kam zum Vorschein.
Selbstbewusstsein war gefragt
Zurück zu unserer „Scherbe“ im Gesicht. Das Salonblatt bestärkte unseren Eitel-Angebert, sich weder vom Spott oder der Wut anderer Leute davon abhalten zu lassen, ein Monokel zu tragen. Denn weder die Hornbrille, noch der Kneifer wären, was Schönheit und Eleganz des Aussehens beträfen, eine Konkurrenz für das Monokel, tröstete die Zeitung. Dazu gab es den eleganten Straßenanzug, einen gepflegten Schnurbart und einen Spazierstock. So ging man in die neuen Klubs und Bars, aber nicht in die Kneipe an der Ecke.
Und was ist mit unserer These?
Hier die Antwort: „Das Monokel zwingt dazu, die Bewegungen des Trägers von ihm abhängig zu machen, d.h. sie ruhig und elegant zu gestalten. Ein Lachen zum Beispiel, bei dem alle Gesichtsmuskeln mitspielen, ist unmöglich. Seelische Erregungen müssen äußerlich gedämpft erscheinen. Und so ist das Monokel eine Art Aufpasser, der das Benehmen seines Trägers mit der guten Kinderstube in Einklang bringt.“
Unter der Rubrik „Vor 100 Jahren“ veröffentlichen wir in loser Reihenfolge Anekdoten aus dem Leben, Handeln und Denken von Uroma und Uropa. Dafür hat der Dresdner Schriftsteller und Journalist Heinz Kulb die Zeitungsarchive in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek durchstöbert.